Leseproben Archiv
 Quelle: Kerstin Laupheimer,
Öl auf Leinwand, 100x100).
Quelle: Kerstin Laupheimer,
Öl auf Leinwand, 100x100).
Sibylle Wegner
Ich sah
Ich sah das Ende, dass in jedem Anfang ist. Ich sah es schon als kleines Kind. Ich sah meinen Großvater sterben.
Ich sah, wie die Menschen um mich ihr Leben weiter lebten und dass er wohl nur bei mir eine nicht mehr verschließbare Lücke hinterließ.
Ich sah viele Anfänge, was ich alles aus meinem Leben machen könnte. Ich sah das mögliche Ende und führte nichts wirklich zu Ende aus Angst davor.
Ich sah das Ende schon im Anfang meiner Liebe und wollte es doch nicht sehen. Ich sah die Probleme und übersah sie. Ich sah das Auseinanderlaufen der Leben und wusste nicht, was ich dagegen tun sollte.
Ich sah den Anfang des Lebens, als mein Patenkind geboren wurde und das Glück im Gesicht der Eltern. Ich sah wie sie heranwuchs, wie sich die Eltern trennten und die Zerrissenheit des Kindes, ich versuchte ihr ein wenig Halt zu geben. Ich sah den Stolz in ihren Augen, als sie das Abitur bestanden hatte. Ich sah ihre zeitweise überdrehte Heiterkeit, auf die ein blasses Gesicht mit tiefen Augenringen über einem wie betäubten Körper folgte. Ich sah ihren ersten Entzug und den zweiten. Ich sah es und wusste nicht, wie ich es aufhalten sollte. Ich sah das Ende und es kam.
Ich sah danach lange keinen Anfang mehr.
Ich sah stets das Ende, lebte aber wie am Anfang – abwartend, als ob ich alle Zeit der Welt hätte.
Am Ende -würde ich gerne nochmal anfangen.
 Hand in Hand schlenderten sie den Weg zwischen den trockenen Feldern entlang. Die spanische Sonne brannte von oben.
Hand in Hand schlenderten sie den Weg zwischen den trockenen Feldern entlang. Die spanische Sonne brannte von oben.
"Ist es dir nicht zu heiß?", fragte Jan.
"Noin", sagte Anna, "geht schon". Sie zeigte auf die nächste Wegbiegung. "Schau mal."
Dort lag ein großer, grauer Felsblock.
"Komisch", Jan ging voraus zu dem Stein, "wie kommt der hierher? Hier liegen sonst weit und breit keine Felsen." Er grinste. "Sieht aus, als ob den ein Riese auf seinem Weg zum Meer hat fallen lassen".
Anna stand jetzt neben ihm. "Was ist das für ein Stein?"
"Hmh. Ich glaube Granit, schwarze, weiße, graue Einschlüsse, hier auch blau und beige. Hübsch," meinte Jan.
Anna war weitergegangen. Er eilte ihr hinterher und ergriff wieder ihre Hand. "Ist dir die Lauferei doch zu viel?" Sie schüttelte nur den Kopf.
An der nächsten Biegung tauchte eine alte Frau auf, von Kopf bis Fuß ganz in schwarz gekleidet mit einer Rose in der Hand. Langsam ging sie an dem Paar vorbei, ohne aufzublicken. Jan und Anna blieben stehen und schauten ihr nach.
Die Frau hielt vor dem Felsblock an und bekreuzigte sich. Dann faltete sie die Hände mit der Rose dazwischen und murmelte etwas.
Jetzt bückte sich die Frau und legte die Rose vor dem Stein ab. Sich mühselig wieder aufrichtend, blickte sie in Richtung des Paares.
"Komm", sagte Anna leise, "lass uns gehen, ich komme mir vor wie ein Voyeur."
Sie wandten sich schnell ab und nahmen den nächsten Feldweg zum Hotel.
"Die Frau hat gebetet", sagte Anna.
"Kann schon sein. Vielleicht ist dort jemand verunglückt. Weißt du, so wie bei uns die Kreuze am Straßenrand stehen." Anna schwieg.
Nach einer Weile meinte sie: "Die Menschen hier sind noch viel mehr mit ihrem Glauben verbunden."
"Ja", sagte Jan, "bei uns spielt der Glaube keine große Rolle mehr und ich finde, das ist gut so. Kein Fanatismus, der die Leute aufwiegelt."
"Jan, bitte", Anna stöhnte und zog ihre Hand aus seiner, "glaubst du nicht, dass die Menschen hier Trost und Halt in ihrem Glauben finden?"
Jan sah erschrocken, dass sie bleich geworden war. "Ja, natürlich bitte entschuldige. So habe ich das doch nicht gemeint. Es ist doch gut, dass wir Releigionsfreiheit haben. Komm hak dich ein, wir sind gleich da."
Den Rest des Weges blieben sie still.
Am Abend im Hotelrestaurant saßen sie nach dem Essen noch bei einem Glas Wein.
Die Bedienung Maria steuerte lächelnd auf ihren Tisch zu.
"Und, haben Sie heute die Gegend erkundet und hat es Ihnen gefallen?"
"Ja", Jan lächelte, "aber ich habe mal eine Frage. Wir haben in den Feldern einen großen Granitblock gesehen und eine alte Frau, die dort eine Rose ablegte."
"Oh!", sagte Maria freudig. "Das ist unser Stein, der Stein der Wunder. Den Menschen aus meinem Dorf ist er heilig, sie gehen dorthin mit ihren Fürbitten. Er hat auch schon Wunder bewirkt - ja wirklich! Der Arm meines Großonkels wurde geheilt und eine Frau ist von ihrem Krebs gesundet! Und ...", sie beugte sich verschwörerisch zu ihnen hinunter und flüsterte:" Der Stein hat ein Geheimnis und manchem, der erhört wurde, zeigte er sich."
"Oh, nee!" rief plötzlich der Gast vom Nebentisch, "es bewölkt sich!"
Maria richtete sich sofort wieder auf und alle starrten zur Glasfront der Terasse. Tatsächlich zog dort eine dunkle Wolkenfront auf.
"Morgen wird es regnen," sagte Maria laut in die Runde.
"Jetzt sind wir extra in die Sonne geflogen, und dann ham wir hier ooch schlechtes Wetter", nölte der Gast nebenan.
"Keine Sorge. Das hält bei uns nie lange. Spätestens übermorgen wird es wieder schön sein!", versprach Maria den Gästen.
Anna zog an Jans Ärmel. "Du, ich bin müde, lass uns aufs Zimmer gehen, bitte."
Sie erhoben sich und Jan bot ihr seinen Arm an.
Anna erwachte früh, sie hatte unruhig geschlafen, (wieder) von Alpträumen geplagt. Jan neben ihr schlief noch ruhig und fest. Sie blickte auf den Wecker. Nach der Uhrzeit hätte es schon viel heller sein müssen, aber die Wolken draußen nahmen wohl das Licht.
Sie tastete auf dem Nachttisch nach der Muschel, die sie am Strand gefunden hatte. Als sie sie mit der Hand umschloss, erfasste sie wieder eine Welle des inneren Schmerzes und der Verzweiflung wie so oft im letzten Jahr – seit der Fehlgeburt.
Jan schien das alles längst verkraftet zu haben und schien wieder gelassen in die Zukunft zu schauen. Aber sie - sie konnte das nicht. Sie war wie diese Muschel in ihrer Hand, eine jetzt leere Hülle, ohne Inhalt.
Sie musste raus hier.
Dem Impuls folgend, aber um Jan nicht zu stören, stand sie vorsichtig auf, zog sich leise die Hose an und warf eine Jacke über, die Muschel steckte sie in die Jackentasche. Leise schloss sie die Tür.
Vor dem Hotel war noch alles ruhig. Einfach nur weg. Noch etwas laufen, bevor der Regen anfängt. Einen Schritt vor den anderen, ohne Nachdenken. Immer weiter.
Plötzlich stand sie vor dem Stein. Ohne, dass es ihr bewusst war, hatten ihre Schritte sie hierhin gelenkt.
Die Rose am Boden war schon fast vertrocknet. Anna legte eine Hand auf den Felsen. Er war noch warm von der Sonne des Vortages, das fühlte sich tröstlich an. Sie schloss die Augen, faltete die Hände und begann zu beten, zum ersten Mal nach Jahrzehnten.
Sie bat um Hilfe für sich und ihren Mann, um Kraft. Dann um die Heilung ihrer Seele und ihres Körpers und darum, dass alles wieder gut werden würde - und um ein Kind.
Die ersten Regentropfen holten sie aus der Versunkenheit. In dicken Klatschen fielen sie ihr auf den Kopf. Sie löste schnell die Hände, nickte noch einmal und zog dann die Muschel aus der Tasche und legte sie vor den Stein. Dann eilte sie zurück in Richtung Hotel. Jan war sicher schon wach und würde sich Sorgen machen.
An der Abzweigung hielt sie an, um noch einmal einen Blick zurück auf den Stein zu werfen.
Sie erstarrte. Der Stein, der vorher hell gewesen war, färbte sich durch das Wasser dunkel und in der Mitte wurde langsam eine Farbstruktur erkennbar: Ein Kreis - und in dem Kreis immer deutlicher - ein Kreuz.
Durch Annas Körper lief ein Schauer. Der Stein hatte ihr sein Geheimnis gezeigt!
Sie spürte eine Ruhe sich in ihr ausbreiten und ein Gefühl der Freude. Ihr Gebet war erhört worden. Sie empfand jetzt ganz deutlich eine Zuversicht, nein - eine Gewissheit:
Sie würde ein Kind haben.
Fenster in die Ewigkeit
Mit weit aufgerissenen Augen und innerlich hellwach stand sie vor der Scheibe und betrachtete fasziniert den Mann. Sie war bestrebt, jedes Detail photographisch in sich aufzunehmen. Er lag ausgestreckt mit majestätisch verschränkten Armen, den Körper von einem Tuch bedeckt. Seine Züge waren fein, die Nase wie gemeißelt, das Kinn leicht gerundet, die Finger zartgliedrig und lang.
Eine Hand legte sich von hinten auf ihre Schulter. Ihr Mann stand hinter ihr. "Na?"
Sie drehte lächelnd den Kopf zu ihm. "Schau mal, Thutmosis, der Vierte. Ich hätte nicht erwartet, dass die Thutmosiden so schöne Männer waren."
Er schüttelte sich gespielt. "Schwarz, schrumpelig und ziemlich klein. Ich weiß nicht, was daran schön ist. Hast du den da hinten gesehen?"
Sie winkte ab. "Das ist Ramses, der Zweite, der wurde über 90 Jahre. Wenn wir mal alt sind, sehen wir auch nicht besser aus."
"Tschuldige, der hier…“, er wies auf den Glaskasten vor sich, "sieht aus wie Holzkohle."
"Das kommt durch die Balsamierungsharze. Nach dem Entfernen der Organe ..."
Er fiel ihr ins Wort: "Das ist morbide. Und überhaupt. Möchtest du dich dreieinhalb Jahrtausende nach deinem Tod noch von Massen von Menschen angaffen lassen?"
Sie holte Luft. "Er war Gott und König, hat seinem Volk und Land gehört. Ich glaube nicht, dass es ihn stört, wenn sein Volk ihn sieht und er so immer noch präsent ist. Das ist doch das, was die alten Ägypter wollten – Unsterblichkeit. Und die haben sie erreicht. Sie sind diejenigen, die der Ewigkeit am nächsten kamen und kommen. Denk an die Pyramiden." Ihre Augen glänzten begeistert.
"Na, die sehen wir ja erst heute Nachmittag. Ich geh schon mal und stell mich bei der Schatzkammer an".
Er wollte ihr einen Kuss auf die Wange geben, aber sie hob gerade noch rechtzeitig mahnend die Hand. Kein Küssen in der Öffentlichkeit, das hatte ihnen ihr Fahrer eingeschärft. Also drückte er ihr nur den Arm und schlenderte aus dem Raum.
Sie blieb noch allein im Mumiensaal, ging von König zu König, genoss die Gegenwart der Großen. Bei Hatschepsut regte sie sich auf. Die große Pharaonin war auf dem Beschriftungsschild nur als Königin, nicht wie die anderen als Pharao bezeichnet.
"Es hört wohl nie auf, dass eine Frau hier nicht zählt, damals nicht und heute", dachte sie traurig.
Sie ging zum Ausgang, blickte sich um, ob sie keiner beobachtete und grüßte verstohlen zum Abschied die Gottkönige mit dem alten Gruß – gebeugter Oberkörper, gesenkter Kopf, leicht nach vorne gehobene Hand. Sie flüsterte die uralte Anbetungsformel: "Gegrüßt seist du, geliebt von Amun, sei heil und gesund für Millionen Jahre."
In den anderen Ausstellungsräumen waren noch so viele Glasvitrinen mit unglaublichen Schätzen darin, dass sie am liebsten Tage hier verbracht hätte.
Später saßen sie auf der Zugangstreppe zum Museum in der prallen Sonne und warteten auf ihren Fahrer. Sie mit dem Gefühl, die Vergangenheit verlassen zu müssen und schwer in die Wirklichkeit zu finden. Er, von den ganzen Exponaten erschöpft und ein wenig gelangweilt.
"Du siehst aus wie eine satte Katze", sagte er.
Sie grinste. "Oh ja, hast du den Haarschmuck der Prinzessin Chnumit gesehen? So filigran aus hauchdünnen Golddrähten mit winzigen Sternchen und Blüten besetzt. Sie war eine Tochter von …"
"Stimmt", sagte er schnell und fest, um den Vortrag, der unweigerlich folgen würde, abzubiegen.
Ihr Blick war unwirsch. "Und? Wo bleibt dein üblicher Satz bei Pracht in Museen und Kirchen?"
"Ja, genau." Er lachte. "Und das Volk hat gehungert!"
"Nein, hier nicht", brauste sie auf. "Was glaubst du, wofür die Pyramiden gebaut wurden? Lohn und Brot für viele und die Bildung eines Staates, ganz abgesehen von der religiösen Bedeutung … "
"Ach, komm lass", flüsterte er.
Sie schluckte und legte die Stirn in Falten.
"Aber der Sonnenbaldachin der Hetepheres, Mutter von Cheops, hat dir doch gefallen?"
"Meinst du den mit der gleichen Klapptechnik wie unser Gartenpavillon?"
"Ja, richtig, und das 2600 vor Christus. Ist das nicht unglaublich?"
Er nickte nur, sonst gingen die Verwandtschaftszuordnungen bei ihr weiter, gefolgt von Ausgrabungsberichten. Dafür war ihm einfach zu heiß.
Ihr schien die Hitze nichts zu machen. Sie hob die Arme, als wollte sie den Himmel umfassen.
"Das hier ist alles ein Schaufenster in die Unsterblichkeit. Sie haben es wirklich geschafft, für ewig zu sein."
"Na, wenn ich an die politische Lage hier denke, weiß ich nicht, wie lange die Exponate noch überleben und die Unsterblichkeit hier dauert", knurrte er.
Ein betroffener Blick war ihre Antwort.
"Lass mir doch diesen einen Tag in der Ewigkeit", bat sie leise.
"Entschuldige!" Er legte den Arm um sie. "Ich liebe dich doch und ich freu mich genau wie du, das hier alles zu sehen. Aber ich habe jetzt auch ein ewiges Gefühl, nämlich Hunger."
Der Fahrer kam.
Nach zweieinhalb weiteren Wochen mit Gizeh, Sakkara, Memphis, der hier wohl nicht vermeidlichen Magen-Darm-Erkrankung, einer Nilkreuzfahrt und ein paar Badetagen in Hurghada war das Ehepaar wieder zu Hause, beide zufrieden.
Wenn man sie heute fragt – ein paar Jahre später – war es für das Paar jeweils ein Traumurlaub. Für sie wegen der Tempel und Sehenswürdigkeiten, für ihn wegen des Badeurlaubs im exzellenten Steigenberger Hotel.
 Er ging am Strand entlang, ganz mit seinen Gedanken beschäftigt. Das Kreischen der Möwen nahm er nicht wahr. Sein eigenes Versagen nagte an ihm. "durchs erste Staatsexamen gerauscht –Looser!" beschimpfte er sich leise. Was sein Vater dazu sagen würde, konnte er sich lebhaft vorstellen. Dass er in die väterliche Kanzlei einsteigen sollte war schon seit seiner Geburt klar gewesen. Dabei fiel ihm das Paragraphenlernen unglaublich schwer, wenn er ehrlich war, langweilte ihn Jura. Er wäre viel lieber Architekt geworden, hätte Häuser gebaut, neue Gebäude entworfen mit noch nie dagewesenen Formen. Er nahm einen Stein hoch und warf ihn ins Meer.
Er müsste es seinem Vater beichten, stattdessen hatte er sich ans Meer geflüchtet, nur noch ein paar Tage gewinnen, bevor er vor seinen Vater trat. Er sah dessen Gesicht vor sich, starr, ohne Minenspiel, er würde nichts sagen, aber die Augen kalt verachtend. Natürlich konnte er einen neuen Anlauf nehmen, die Prüfung in einem Jahr wiederholen, aber was wenn er wieder versagen würde.
Er sah aufs Wasser, als ob er am geraden Strich des Horizontes Halt finden könnte.
Er ging am Strand entlang, ganz mit seinen Gedanken beschäftigt. Das Kreischen der Möwen nahm er nicht wahr. Sein eigenes Versagen nagte an ihm. "durchs erste Staatsexamen gerauscht –Looser!" beschimpfte er sich leise. Was sein Vater dazu sagen würde, konnte er sich lebhaft vorstellen. Dass er in die väterliche Kanzlei einsteigen sollte war schon seit seiner Geburt klar gewesen. Dabei fiel ihm das Paragraphenlernen unglaublich schwer, wenn er ehrlich war, langweilte ihn Jura. Er wäre viel lieber Architekt geworden, hätte Häuser gebaut, neue Gebäude entworfen mit noch nie dagewesenen Formen. Er nahm einen Stein hoch und warf ihn ins Meer.
Er müsste es seinem Vater beichten, stattdessen hatte er sich ans Meer geflüchtet, nur noch ein paar Tage gewinnen, bevor er vor seinen Vater trat. Er sah dessen Gesicht vor sich, starr, ohne Minenspiel, er würde nichts sagen, aber die Augen kalt verachtend. Natürlich konnte er einen neuen Anlauf nehmen, die Prüfung in einem Jahr wiederholen, aber was wenn er wieder versagen würde.
Er sah aufs Wasser, als ob er am geraden Strich des Horizontes Halt finden könnte.
Der Strand war noch leer am frühen Vormittag, nur weiter vorne auf einem Steinhaufen sah er schemenhaft die Gestalt einer Frau sitzen. Er blieb stehen, er wollte jetzt keinen Menschen sehen, grüßen oder sonst einen Kontakt, aber die Unbekannte zog seinen Blick an. Wie verloren sie in der Einsamkeit wirkte. Alles an ihr war mädchenhaft, das rosa Schultertuch, Jeans, Turnschuhe, die halblangen Haare verdeckten ihr Gesicht und wurden nur ab und zu vom Wind leicht bewegt. Sie hob den Kopf und blickte aufs Meer, jetzt senkte sie ihn wieder hinunter.
Er hätte gern gesehen, was sie dort tat, was ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich zog und sie so entspannt wirken ließ, aber er wagte es nicht, näher zu gehen, einen Blick zu riskieren und sie anzusprechen. Stattdessen drehte er um und ging zurück ins Hotel.
Wieder war er am Strand, die Sonne stand noch nicht hoch und er ging auf die Felsen zu, suchte die Mädchenfrau. Diesmal würde er nicht feige umdrehen.
Da saß sie. Wie zuvor mit dem rosa Schultertuch, das Gesicht vom Haar verdeckt. Er ging näher. Auf den Knien hielt sie etwas, vielleicht eine Leinwand, vielleicht eine Kladde. Sie schrieb oder malte und war ganz auf ihre Arbeit konzentriert. Fasziniert beobachtete er sie weiter. Wie alt sie wohl war? Das Meer schien sie auch zu beobachten. Der Wind wehte einen Geruch herüber, den er erkannte. Ölfarbe, sie malte mit Öl. Hier am Strand? Nicht ungefährlich, ein kräftiger Windstoß und der Sand klebte auf den Farben. Aber Öl konnte das ab. Mit Ölfarben schuf sie etwas Bleibendes für die Ewigkeit. Sie war frei, durfte ihrer Kunst nachgehen, er beneidete sie. Dann zog er seine Pocketkamera heraus und machte ein Foto. Wie sie da saß, das Meer betrachtete, die Leinwand wie einen Schatz vor dem Körper, ganz klein gegen die Elemente und doch eins mit ihnen. Von weitem näherte sich ein Klingeln.
Vielleicht ein Fahrradfahrer auf dem Dünenkamm, der auf sich aufmerksam machten wollte. Er ging noch näher und konnte einen Blick auf das Bild werfen. Vor Überraschung hielt er den Atem an. Was er sah, war das Bild was er gerade fotografiert hatte. Das Mädchen am Strand mit Schultertuch, das Gesicht abgewandt, verdeckt von den Haaren. Er hatte plötzlich das Gefühl in einem Spiegelkabinett zu stehen. Das Klingeln war wieder zu hören, lauter, als ob der Radfahrer auf den Strand gewechselt hatte und näher kam.
Sie hörte das Klingeln wohl auch. Ihr Kopf flog hoch, erschrocken raffte sie alles zusammen. „Bitte, sie dürfen mich nicht verraten, ich darf nicht hier sein“, stammelte sie.
„"Warum?"
"Ach. Meine Familie – für sie ist Malen brotlose Kunst. Bitte, sie haben mich nicht gesehen, versprechen Sie das?" Sie raffte schnell ihre Sachen zusammen.
"Ich verspreche es", sagte er. Sie war schon auf dem Weg zur Düne.
"Ich verstehe“, rief er ihr nach, „ besser als Sie wissen!"
Das Klingeln war nun ohrenbetäubend und ganz nah. Wütend drehte er sich um
und knallte mit dem Ellenbogen gegen etwas Hartes.
Der Schmerz machte ihn sofort hellwach, er lag im Hotelbett, Das Klingeln war der Wecker auf dem Nachtschränkchen, gegen das er gestoßen war. Langsam kam die Erinnerung, er hatte sich abends extra den Wecker gestellt, um wieder zum Strand zu gehen und nach der Mädchenfrau zu sehen. Es war ein Traum gewesen, dass er mit ihr gesprochen hatte.
Er sprang aus dem Bett, machte nur eine kurze Katzenwäsche und lief ohne Frühstück zum Strand, lief weiter bis er die Steine erreichte. Sie war nicht da. Lange wartete er, starrte auf das Meer, lief vor den Steinen auf und ab. Nach einigen Stunden gab er es auf.
Sie war auch am nächsten Tag nicht da. Er wartete weiter, wollte ihr sagen, wie schön das Bild war, was sie malte.
Nach weiteren Tagen hatte er begriffen – dass sie nicht mehr kommen würde - aber auch, was er jetzt tun musste. Seinem Vater sagen, dass er mit Jura aufhörte und ein Architekturstudium beginnen würde.
Er wusste nun, was der Traum bedeutete, was es bedeutete wenn man seinen Traum nicht lebt.

Quelle: privat
Sylvia Mandt
Am Beispiel des Mangrovenwaldes
- Eine Parabel – (von Sylvia Mandt)
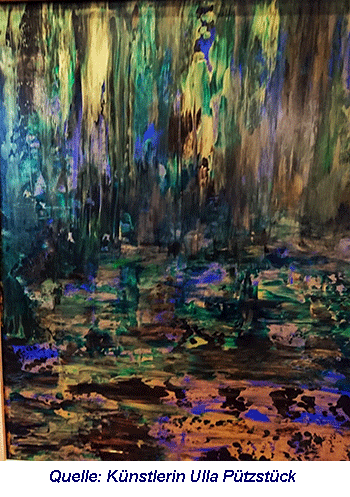 Du führtest mich in eine fremde Welt,
Du führtest mich in eine fremde Welt,
sagtest, es sei ein magischer Ort.
Wild und betörend,
wie geschaffen für unsere Liebe.
Ich ging mit dir,
all meine Hingabe
und all mein Vertrauen im Gepäck,
genug für ein ganzes Leben.
Der Ort, weit weg von überall,
war weder Land noch Meer.
Oben und unten schienen
zu einem Dickicht der Gefühle
zusammengewachsen zu sein.
Eingetaucht in Feuchtigkeit und Wärme
verschmolzen du und ich zu einem Wir,
so wie am Ursprung allen Lebens.
Zwei Teile eines Ganzen
trieben im Kosmos
der erfüllten Sehnsüchte
auf eine Ewigkeit zu.
Als wir an die Grenzen der Ewigkeit stießen,
hielt ich mich an dir fest,
ebenso erfüllt wie verloren.
Zwischen Halt und Auflösung
suchte ich den gemeinsamen Himmel,
immer wieder.
Ich fand ihn nicht.
Das dichte Blattwerk hüllte mich
in Dunkelheit und Angst...
Du gingst - und kamst zurück,
mit Berührungen,
mit Versprechungen,
die ich viel zu lange glaubte.
Plötzlich schämte ich mich
meiner Nacktheit, meiner bedingungslosen Liebe.
Verlassen, verletzt, verbraucht -
durch dich.
Die Falle war zugeschnappt.
Lange lag ich starr,
dem Fraß der wilden Tiere ausgeliefert.
Als die Nacht kam,
ächzten die Bäume, Wasser schäumte ungestüm.
Die Tiere des Waldes gerieten in Unruhe,
und der Ruf der weisen Eule
kündete Schicksalhaftes an:
Deine Täuschung würde
einen Orkan der Entrüstung auslösen,
in einer Welt,
die aus Liebe geboren war.
Der Sturm zerfetzte das Blätterdach
und ermöglichte gleichzeitig den Blick
auf einen klaren, grenzenlosen Himmel,
den ich schon lange vermisst hatte.
Gestirne funkelten mir zu
und verhießen Gutes.
Der Morgen bedeckte meine Scham,
und Wärme umhüllte meine Nacktheit.
Aus dem Urwald der Verwirrung
wies mir ein Sonnenstrahl den Weg.
In mir wuchs ein starker Wille,
nährte Geist und Seele -
und gab mich frei.
Auf jenem Weg
hab’ ich die Liebe
zu mir selbst gefunden.
Genug auch für ein Du,
das meiner Liebe würdig ist.
Nur kurz schau’ ich mich um
und seh’ dich dort in deinem Baumhaus hocken.
Vielleicht sitzt du jetzt in der Falle,
vielleicht lauerst du auf die nächste Beute.
Vielleicht aber kannst du verstehen,
dass die Liebe und der Wald
jeglichen Schutzes bedürfen.
Siehst du die Heckenrosen dort?
Sie blühen rosa, dunkelrot und weiß.
In Büschen steh'n sie dicht zusammen
und duften sanft wenn’s warm ist oder heiß.
Die Erde, die sie nährt, ist karg,
meist sandig und die Wurzeln ohne Halt,
wo doch der Sturm die Büsche beutelt,
sind sie gemeinsam tapfer und auch stark.
Die Blütenblätter, zart wie feinste Seide,
umrahmen eine Mitte pudrig gelb
und geben so der oftmals öden Heide
ein Antlitz freundlich, mild, nie herb.
Der Früchte Trank erwärmt und nährt die Seele,
der Samen Haken schaffen Heiterkeit,
und Lachen schallt wie aus der Kinderkehle
bis in des Alters hohe Zeit.
Nun denk’ einmal, wenn so die Liebe wäre,
zart blühend mit Bescheidenheit,
zusammenhaltend wie in starkem Heere,
ganz ohne Panzer, nur im Sommerkleid,
dann könnt’ es mehr noch von uns geben,
die glücklich wären, ohne Neid.
Und Reichtum wär’ nicht mehr ihr Streben-
wie wär’s mit Ehrfurcht vor der Einfachheit?
Und glaubst du’s nicht, lies noch einmal!
Das Beste zeigt sich nicht beim ersten Blick.
Und wenn du dann erkennst aufmal,
dann willst du niemals mehr zurück.
Zur Finissage der Bilder-Ausstellung von Wolfgang Mummert las Sylvia Mandt
zu dem Bild "Entdeckerin", Sumatra/Indonesien 2012, ihren Text

"Begegnungen mit Raya"
Heute besuche ich dich zum letzten Mal. In den vergangenen Wochen habe ich mich oft zu dir gesetzt, dich betrachtet und mich mit dir auf eine ganz besondere Weise unterhalten. Ich habe dich mir vertraut gemacht, wie sich der kleine Prinz den Fuchs vertraut gemacht hat.
Und nun müssen wir Abschied nehmen.
Weißt du noch, wie ich dich bei unserer ersten Begegnung ansah und so wenig mit dir anfangen konnte? Ich wusste nichts von dir, außer dass du auf der Insel Sumatra in Indonesien lebst.
Ich wusste auch nur Ungefähres über dieses Land, das so weit weg ist, weiter als ich mir zu reisen vorstellen konnte.
Aber du, du hieltest meinen Blick gefangen. Ich wurde neugierig auf dich. Wer magst du sein? Wie alt bist du? Wie ist dein Name? Und vor allem:
Warum ist dein Blick so, wie er ist?
Hast du etwas entdeckt, was dich beschäftigt?
Mit diesen Fragen verließ ich dich. Ich wusste, ich würde wiederkommen.
Beim zweiten Mal, als ich zu dir kam, gab ich dir einen Namen, den in einer Liste mit indonesischen Mädchennamen fand: Raya.
Der Name gefiel mir für dich.
Ich hatte auch schon ein Buch über Indonesien bestellt und begonnen, im Internet Wissenswertes herauszufinden.
So erfuhr ich, dass das Land mehr als siebzehntausend Inseln hat. Dass durch Sumatra, die größte Insel des Staates, genau in der Mitte der Äquator verläuft. Und dass auf der zweitgrößten Insel, Java, mehr als die Hälfte der Einwohner des Landes leben.
Insgesamt sind es mehr als siebzehntausend Inseln mit über zweihundertfünfzig Millionen Einwohnern. Was für Dimensionen!
Erinnerst du dich, Raya, an meinen dritten Besuch? Da habe ich dir gesagt, dass ich eine halbe Ewigkeit bräuchte, um mich in die Vielfältigkeit deines Heimatlandes einzuarbeiten. Soviel Zeit haben wir beide gar nicht miteinander.
Deshalb beschloss ich, mich hauptsächlich mit Sumatra zu beschäftigen. Und das ist schon eine Herausforderung!
Ich las in einem Reisemagazin von der Schönheit der
Insel. In den tropischen Regenwäldern kann man auf Safari gehen und Nashornvögel, Sumatra-Tiger und Orang- Utans beobachten, in Schnorchelschulen eine vielfältige Unterwasserwelt kennenlernen, auf über dreitausend Meter hohe aktive Vulkane klettern und am Lake Toba, dem höchsten Kratersee der Erde, spazieren gehen.
Du wirst bemerkt haben, wie begeistert ich von der überwältigenden Schönheit und Vielfalt deiner Heimat war!
Ganz zu schweigen von den schönsten Fotos, die ich je von Land und Meer gesehen habe.
Ich hatte so gehofft, dich einmal lächeln zu sehen. Aber dein Gesichtsausdruck veränderte sich nicht. Nach wie vor schienst du in Gedanken, ja, sogar besorgt zu sein.
Also muss ich noch weiter forschen, um dich zu verstehen? Nachdenklich ging ich nach Hause.
Natürlich, Raya, ich weiß, dass das Inselland Indonesien, Sumatra im Besonderen, von Naturkatastrophen heimgesucht wurde. Es keine Sicherheit gibt, dass es nicht wieder schwere Erd- oder Seebeben geben wird und niemand weiß, wann etwas passiert.
Die australische Platte vor der Südwestküste Sumatras bewegt sich, und daher kommt das Gebiet nicht zur Ruhe.
Ich erinnere mich jetzt, dass ich das vor sehr vielen Jahren schon einmal in der Schule gelernt habe.
Auf einer neueren Karte sah ich die Aufreihung aktiver Vulkane entlang der Küste.
Und auf einer Jahrestabelle reiht sich Erdbeben an Seebeben, in einer Häufigkeit, dass mir ganz schwindelig wurde. Ich habe das so nicht gewusst.
Tausende Obdachlose, Verschüttete und viele Tote sind fast immer die schrecklichen Folgen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Das alles war in meinem Kopf, als ich erneut zu dir kam.
Wie lebt es sich in einer solchen Region? fragte ich dich, nun auch selbst besorgt.
Ein Kind weiß sicher noch nicht so viel davon. Die Kinder in Indonesien werden besonders geliebt, behütet und beschützt, ja überall mit herumgetragen und liebkost, wie wir das hier in Europa gar nicht kennen.
Indonesische Kinder sind sorgenfreie, glückliche Kinder, sagt man.
Ich vermute, du bist an der Grenze zum Erwachsenwerden. Und ich glaube, dass du beginnst, die Situation anders
wahrzunehmen. Aber wie? Als Tanz auf dem Vulkan oder als ständige Bedrohung und Angst?
Ist es das, was dich beschäftigt, Raya?
Bei unserer vorletzten Begegnung war mir klar, dass bei der Beschäftigung mit deinem Land mehr Fragen bleiben als Antworten gegeben werden können.
Wie zum Beispiel die Frage nach der Landesgeschichte, die Zeit Indonesiens als niederländische Kolonie, die
japanische Besatzungszeit, die Unabhängigkeit und die derzeitige Politik.
Natürlich interessieren mich auch die Themen Menschenrechte, Religionen und die Stellung der Frau in der Gesellschaft.
Ich bin nicht sicher, wie viel und ob Du überhaupt schon etwas darüber weißt.
Hinter dir sehe ich eine Frau mit Kopftuch, wahrscheinlich deine Mutter. Ich vermute, dass deine Familie muslimischen Glaubens ist, wie die meisten Menschen in Indonesien.
Bist auch du ein glückliches Kind?
Wie wird deine Zukunft aussehen, Raya, welche Hoffnungen und Wünsche hast du?
Du bleibst heute wie immer still. Auch ich werde für heute still sein. Aber nächste Woche, wenn ich zum letzten Mal komme, dann muss ich dir noch eine Frage stellen!
Heute bin ich traurig. Weil ich mich mit dir vertraut gemacht habe, und weil wir nun Abschied nehmen müssen.
Aber da ist noch diese letzte, die im wahrsten Sinne des Wortes, brennende Frage. Als ich darüber las und sogar einen Film sah, war ich so schockiert, dass ich mich noch gar nicht getraut habe, dich darauf anzusprechen.
Es hatte mir sozusagen die Sprache verschlagen, die Luft zum Atmen genommen:
Denn es gibt dort Menschen, die vernichten den einzigartigen Regenwald der Ureinwohner Sumatras, vernichten ihn Stück für Stück.
Zuerst haben sie mit Kettensägen die uralten Bäume gefällt, die den Ruf der Insel als grüne Lunge der Welt
begründeten.
Riesige Flächen wurden abgeholzt, und damit den seltenen Tieren die Lebensgrundlage entzogen.
Das kann nicht wahr sein, dachte ich, aber es kam noch schlimmer:
Diese Menschen stellten später fest, dass es billiger sei, den Wald einfach abzufackeln, die kostbaren Bäume und Pflanzen auf unzähligen Quadratkilometern nieder zu brennen und dabei die Tiere zu verjagen und zu töten.
Die meisten Arten sind ohnehin längst vom Aussterben bedroht.
Das aber ist den Erfindern des Unheils gleichgültig. Hauptsache, sie hatten und haben ihren Profit! Indonesien kam in den Verruf des Klimavernichters. Und wozu?
Zur Palmölgewinnung!!! Riesige Plantagen dienen dazu, dass in den Industriestaaten billige Kosmetik, Waschmittel und sogenannter Biotreibstoff hergestellt werden können.
Ja, geht’s noch?
Ich habe geweint, Raya, wie ich auch jetzt weine. Und ich frage dich: Ist es das, was dich besorgt und ängstigt? Ist dein Blick zu den Rauchschwaden der brennenden Wälder, die den Himmel verdunkeln, gerichtet?
Meine Augen schwimmen in Tränen. Und dann sehe ich plötzlich dich, wie du dich zu mir umdrehst, und ich sehe auch dich weinen.
Nur Sekunden.
Dann bist du verschwunden.

Quelle: Martina Hörle
Karla J. Butterfield
"Eine Weihnachtsgeschichte"
Irgendwo zwischen Afghanistan und Syrien.
Jupps Augen brennen. Um ihn herum nur Dunkelheit. So dicht, so wie die Luft. Zum Schneiden. Und dann der Benzingestank. Er brennt sich in seine Nase ein, in seine Lunge. Langsam nimmt Jupp die Umgebung wahr: Stöhnen, Gebete, es riecht nach Erbrochenem, Exkrementen. Kinder wimmern. Eine schmale Hand ergreift sein Handgelenk. Ist es schon der Tod? Die Dämpfe schläfern ihn ein, dann Stille, nur dass Holpern des Tankzuges.
Die Tür wird aufgerissen. Das Licht entblößt Menschenbündel, die wie ein Auswurf aus der offenen Tür herausquellen. Viele drängen hinaus, einige bleiben liegen. Er hatte schon lange keinen Stoff genommen, aber sein Kopf fühlt sich an wie nach einem schlechten Trip. Etwas klammert sich an seine Jacke und hält ihn zurück. Dunkle Augen hinter einer Burka. Jupp befreit sich aus ihrer Umklammerung. Bleibt stehen, schaut zurück. Sie liegt im Schlamm auf dem Rücken. Eine zierliche Gestalt. Unter dem Kaftan zeichnet sich ein praller Bauch ab. Jupp geht zurück und hilft ihr hoch. "Kannst du gehen?" fragt er auf Englisch. Sie antwortet nicht, aber lässt sich führen.
"Your name?", fragt er und haut sich gegen die Brust: "My name is Jupp".
"Malalai", antworten die Augen.
Nach weiteren sechzehn Stunden Fußmarsch und zweitägiger Zugreise in einem Viehwagen werden sie von der Bulgarischen Grenzpolizei aufgesammelt und ins Auffanglager Harmanli geführt. Der Offizier mit blutunterlaufenen Augen sitzt breitbeinig hinter einem provisorischen Schreibtisch und mustert Malalai. "Passoporto" Malalai senkt ihren Blick. Der Offizier ächzt, als wäre sie ein ungezogenes Kind. "Name", "Malalai", weiter! "Al Zain", "Country", "Afghanistan". Dann gleitet sein Blick zu Malalais Bauch und weiter zum Jupp. "Father?". Jupp nickt. Malalais Augen weiten sich. "Married?"… "Yes". Der Offizier schreibt den Namen Al Zain auf ein nummeriertes Blatt und reicht es den beiden über den Tisch.
In einem großen Militärzelt bekommen Jupp und Malalai zwei Liegen hinter einem Jutevorhang zugeteilt. Die Decken sind schmutzig, Kissen gibt es keine. "Ich besorge Wasser", sagt Jupp und macht sich auf die Suche. Als er zurückkommt, ist Malalai bereits eingeschlafen.
Das Lager besteht aus einem roten und einem weißen Container, der Rest sind eng ineinander gebaute Militärzelte soweit das Auge reicht. Links drei Duschen und drei Latrinen. Überall Rauch, der von den unzähligen Feuerstellen aufsteigt, über denen große Bottiche mit undefinierbaren Speisen baumeln. Es riecht nach Suppe, Feuchtigkeit und Unrat. Unzählige Wäscheleinen. Im Schlamm spielende Kinder. Dazwischen einige kränkliche Hühner.
Der Raum, der ihre Welt bedeutet, ist eng. Eine Gefängniszelle wäre anders. Das hier ist die Freiheit. Und doch nicht. Jupp schält Kartoffeln und betrachtet Malalai, wie sie ihre langen Haare kämmt. Sie hatte die Burka abgenommen, ihm aber den Rücken zugewandt.
"Why you here?" fragt sie, ohne sich umzudrehen.
"Police, and you?"
"Taliban".
Jupp sagt nicht, dass er sich mit der Drogenmafia eingelassen hatte und überall gesucht wird. Da war der Flüchtlingszug die beste Tarnung und der einzige Ausweg. Malalai sagt nicht, dass sie sich Monate vor den Taliban versteckt hielt, dass ihr Cousin, ihre Schwangerschaft verraten hatte, und dass die Steinigung am nächsten Morgen stattfinden sollte. Das Stadion war ausverkauft, das Loch bereits ausgehoben.
Sie bleiben zusammen, mischen sich nicht unter die anderen. Malalai wegen ihres Bauches, sie will niemanden treffen, der sie vielleicht kennt. Jupp, weil er nicht ihre Sprache spricht.
Die Welt jenseits des Vorhanges ist gefährlich, aber in der kleinen abgetrennten Ecke wird den beiden warm ums Herz. Jupp findet im Schlamm einen Dichtungsring und schiebt ihn Malalai auf ihren Ringfinger. "We married." Malalai dreht sich zu ihm hin und in den braunen Augen sieht er Glück. Die Zeit vergeht, Malalai bringt Jupp Farsi bei und wickelt ihm einen Turban um. " Now your name Jussuf, do not forget".
"Jussuf – schöner Name."
Der Winter ist hart, auch in Bulgarien. Jussuf und Malalai schlafen eng umschlungen und wärmen sich gegenseitig. Es ist der 24. Dezember. Kein besonderer Tag, denn hier gibt es keine Christen. Malalai ächzt und schreit - nur einmal - wie ein Falke. Und dann ist das Kind da. Ein kleines Bündel aus Knochen und Fleisch. Jussuf schließt es in die Arme. "My son".
Irgendwo in Europa.
Fernsehnachrichten aus aller Welt. "Guten Abend, meine Damen und Herren, hier ist die Tagesschau. Die endgültigen Resultate der Volkszählung liegen vor. Der Zentralcomputer meldet, dass vor einigen Stunden der siebeneinhalbmilliardste gezählte Weltenbürger geboren wurde. Das Kind zweier Afghanischer Flüchtlinge erblickte die Welt um 00.00 Uhr europäischer Zeit. Gesandte der USA, Europa und Afrika sind auf dem Weg zu der beneidenswerten Familie, um ihre Glückwünsche zu überbringen.
Zwei Tage später im Lager Harmanli
Die krächzende Stimme des Offiziers ertönt bedrohlich aus den an Bäumen befestigten Lautsprechern: "Jussuf and Malalai Al Zain, immediately come to officers office. Jussuf and Malalai Al Zain, are requested to come to the headquarters. This is an order."
Malalai drückt das Neugeborene an ihre Brust. In ihren Augen ist Panik. Jupps Gedanken rasen. Sie müssen weg. So schnell wie möglich. "Komm". Er schiebt Malalai und das Baby durch das Loch in der hinteren Wand des Zeltes. Sammelt ein paar Kleidungstücke zusammen und folgt den beiden. Sie wollen in den Wald, aber das Lager ist mit Maschendraht umzäunt. Im Schutz der dichten Büsche schleichen sie zum weißen Container, hinter dem sich eine Öffnung im Zaum befindet. Jupp weiß es, er hat es bei der Ankunft gesehen. Vor dem Eingang hat sich eine Gruppe Menschen versammelt, die durcheinander und lautstark reden. Es scheint, ein neuer Schub Flüchtlinge ist eingetroffen. Die Wachsoldaten sind abgelenkt. Nur noch zwei Schritte und sie sind draußen. "Wenn sie schießen, gebe ich dir Deckung, und du rennst so schnell du kannst zum Wald", flüstert Jupp. "Los!"
"Stop, do not move!" ruft der Offizier hinter ihnen.
"Gott bless your family!"
Malalai und Jupp drehen sich um. Das Baby weint. Aus der Menge lösen sich drei Männer in teuren Anzügen. Die Menge jubelt.
"Congratulation to the seven and half billionth citizen", sagt der kleinste von den dreien und schüttelt Jupp die Hand.
Er zeigt mit seinem Arm auf die Menschentraube, die sich vor dem Eingang versammelt hatte. In ihrer Mitte glänzt in der Wintersonne ein weißer fabrikneuer Mercedes.
"Gift for your baby."
Schon drängt sich der zweite edle Herr nach vorne.
"This is our gift, Gott bless you." Und wendet sich dann um zu dem Kamerateam und der Presse-Meute, die surrend und klickend um ihn herum schwirrt. Er zeigt auf einen riesengroßen Plasmabildschirm. Die Menge jubiliert.
"And last not least", sagt der dritte edler Herr mit dunkler Haut, "from Afrika for your child."
Diesmal ist es eine X-Box der besten Sorte.
Die Sekretäre der Gesandten drängen zum Aufbruch. Denn es gibt heute noch Vieles zu erledigen. Ein gewaltiger Wind kommt auf. Die Gesandten halten ihre Hüte fest. Der Hubschrauber steigt wie ein riesiger Vogel in den Himmel hinauf. Kaum einen Lidschlag später ist er zu einer glänzenden Libelle geschrumpft.
Danach Stille. Malalai und Jupp betrachten die Geschenke als wären sie UFOs. Die Menge schließt sich. Jeder will die Wunder anfassen. Jeder will am Glück teilhaben. Auch die Wachsoldaten sind sprachlos.
An diesem Abend wird ein großes Fest gefeiert. Die Hühner zu Ehren der glücklichen Familie geschlachtet und über dem Feuer gegrillt. Die Soldaten spenden Pliska. Es wird gesungen und getanzt. Malalai und Jussuf werden auf Händen getragen.
"Schau dir die Sterne an, Malalai", sagt Jupp, als alle, auch die Trinkfesten der Schlaf in die Arme geschlossen hatte, "noch nie war der Nachthimmel so klar. Und da ein Komet! Das bringt Glück."
Einige Jahre später im Lager Harmanli:
Malalai, Jussuf und der kleine Yasoua wohnen in einem größeren Zelt. Malalais Bauch spannt wieder ihren Kaftan. Es hatte endlich aufgehört zu regnen. Yasoua springt in den Pfützen herum. Das Wasser spritzt. Dann klettert er auf einen Hügel, der ganz mit Moos bewachsen ist. Er setzt sich auf seine Spitze wie ein König.
Er weiß nicht, dass unter ihm ein weißer Mercedes, ein Plasmabildschirm und eine exklusive X-Box vergraben sind. Rostig, unbrauchbar, vergessen. Mit Moos und Gräsern bewachsen. Er weiß nicht, dass es kein Benzin gibt, keinen Strom oder Fernsehanschluss im Lager Harmanli – dass seine Eltern ärmer sind als die ärmste Maus.
So bleiben die Gaben unbenutzt. Sie sind zu Yasouas Hügel geworden. Von dem er in die tiefste Pfütze springen und die streunenden Hunde nass spritzen kann. Was für ein Vergnügen!
"Wenn der Koch zweimal ruft"
Wenn Sie mir eine Freude bereiten wollen, laden Sie mich zu Essen ein. Ich liebe es, essen zu gehen. Ich liebe es, wenn mir jemand das Essen vor die Nase stellt. Ich brauche dann nichts mehr zu tun, als die Serviette auf meinen Knien auszubreiten, Gabel und Messer zu ergreifen, kauen, den Wein genießen. Ab und zu einen Blick zum Kellner werfen, der sofort zu mir eilt und mir jeden Wunsch erfüllt. Eiswürfel in den Rosé, Öl für den Salat, mehr geröstetes Brot, alles, was mein Herz begehrt.
In diesem Moment ist es mir egal, wer mir gerade gegenüber sitzt. Hauptsache, er ermutigt mich, noch ein Dessert zu nehmen oder Kaffee oder Grappa oder alles zusammen. Auf einen Aperitif oder eine Vorspeise bin ich nicht so scharf. Aber ich würde nie Nein sagen, nie!
Es ist mir auch einerlei, ob das Essen hervorragend oder gerade so lala ist. Der Salat schmeckt im Restaurant frischer, der Wein mundet besser, das Fleisch ist a point, und das alles nur, weil ich es nicht einkaufen, auspacken, putzen, schnippeln, braten oder panieren muss. Und noch etwas: Ich kann herumbröseln und die Tischdecke versauen, ohne die Konsequenzen tragen zu müssen.
Doch wie das Leben es einem so oft serviert, ist mein Mann absolut kein Restaurant-Begeisterter. Er ist beruflich viel unterwegs und ernährt sich sozusagen nur vom Feinsten, was er aber keineswegs würdigt. Er kennt alle Speisen auswendig, vom indischen Curry bis zum Barbecue. Alles. Er liebt es, zu Hause zu essen. Das sagt er zwar nicht so direkt, aber wenn ich vorschlage, essen zu gehen, setzt er das Gesicht eines Märtyrers auf. Er verlangt aber auch nicht von mir, dass ich koche. Er ist sehr genügsam und ist mit einer Stulle zufrieden. Aber ich nicht! Ich habe Hunger, verdammt, und will keine Stulle auf einem Brettchen mit geschnitzten bayerischen Motiven auf dem Tisch. Ich will keine Radieschen in den Hüttenkäse tunken, die übrigens ich vorher waschen und von welken Blättern befreien muss. Nein, ich will einen übergroßen Teller vor mir haben. Nicht wegen der Menge, die darauf passt. Es ist bloß so, dass große Teller schick sind und noch schicker, wenn man sie nicht selbst füllen muss.
Ich weiß, Sie fragen jetzt: Warum kocht der verdammte Mann nicht selbst? Wir haben immerhin Gleichberechtigung. Ja er würde, aber er kann nicht. Er kann es einfach nicht! Oder tut er nur so? Er sagt auch nicht: „Ich möchte, dass du kochst“. Nein, er fragt nur so rhetorisch, oder so wie Hamlet, der sein Dasein hinterfragt: „Kann es sein, dass ich Hunger habe?“ In diesem Moment könnte ich ihn würgen und paniert verspeisen. Aber da ich hungrig bin, koche ich, wenn auch widerwillig, etwas "Schnelles".
Mir zuliebe schlug er an meinem letzten Geburtstag vor, dass er selbst das Essen vorbereiten würde. Ein größeres Opfer konnte ich von ihm nicht erwarten. Es war herrlich. Ich musste nicht einmal überlegen, was gekocht wird, oder gar einkaufen gehen, nichts. Während er sich in die Küche verzog, wälzte ich mich wohlig auf dem Sofa und hörte dem Klappern von Geschirr und Pfannen zu. Da er absolut ungeübt ist, musste ich ihm ab und zu kleine Hilfestellungen geben, extra hart wollte ich nicht zu ihm sein. Er schnippelte und rührte, köchelte und walkte. Der Himmel auf Erden. "Wo ist das Öl?", kam ein Hilferuf aus der Küche. "In der grünen Flahasche!", belehrte ich ihn und schloss in freudiger Erwartung die Augen. Dann war Stille, nur das Brutzeln von gebratenem Fleisch war zu hören. Ich hatte Großes vor, ich hegte die Hoffnung auf weitere Abende, die diesem folgen werden. Plötzlich breitete sich ein völlig undefinierbarer Geruch in der Wohnung aus. Es roch nach Limonade, welken Blumen, Zitrone. Die entspannte Haltung, die ich gerade hegte, veränderte sich in tierisches Lauern. Alle meine Sinne waren alarmiert. Was war das? Was trieb er dort? Panthergleich sprang ich vom Sofa und rannte zur Küche. Das Fleisch in der Pfanne schwamm in einer grünbraunen, blasenwerfenden Soße. Das flüchtende Fleischfett verdrückte sich ängstlich zum Rand des Gefäßes, das Gemüse glänzte, und ich schrie. Mein Koch in Ausbildung stand vor dem Herd und schaute mich konfus an, in der einen Hand den Kochlöffel, in der anderen eine grüne Flasche, die ich sofort als Spüli identifizierte.
Das Ganze mit Liebe gekochte Essen landete im Mülleimer, und wir MUSSTEN essen gehen. Ich versprach meinem Mann, diesen Vorfall quasi zu vergessen, oder mindestens nicht vor Fremden zu erwähnen. Dafür wurde ich belohnt: Seit diesem Tag werde ich nach Begehr zum Essen ausgeführt. Die restlichen Tage lebe ich von der Luft und von der Vorfreude auf den nächsten Restaurantbesuch.
Ich zählte die Bäume zu einer Melodie, die aus meinem Herzen kam, als ich zu dir ging. Die Birken auf der Linken zählte ich auf dem Hinweg, die Kastanien auf dem Rückweg. Draußen das Rauschen der Blätter, in mir dein Atem.
 Es war Sommer, alles glänzte, war voller Farben. Mein Heimatdorf war fünf Kilometer von Deinem entfernt. Diese fünf Kilometer waren damals mein Leben. Fünf Kilometer, die mich von dir trennten, fünf, die mich zu dir führten. Immer gleich lang und doch so unterschiedlich. Hin ging ich leichtfüßig, ich flog, spürte den Boden unter meinen Füßen kaum und zählte die Birken. Die Sehnsucht verwirrte meine Sinne und ich verdrehte mich in den Zahlen wie in einem verhedderten Wollknäuel. Ich verzählte mich jedes Mal. Waren es sechshundert, oder doppelt so viel? Während die Zahlen noch in meinem Kopf schwirrten, lag ich schon in deinen Armen.
Es war Sommer, alles glänzte, war voller Farben. Mein Heimatdorf war fünf Kilometer von Deinem entfernt. Diese fünf Kilometer waren damals mein Leben. Fünf Kilometer, die mich von dir trennten, fünf, die mich zu dir führten. Immer gleich lang und doch so unterschiedlich. Hin ging ich leichtfüßig, ich flog, spürte den Boden unter meinen Füßen kaum und zählte die Birken. Die Sehnsucht verwirrte meine Sinne und ich verdrehte mich in den Zahlen wie in einem verhedderten Wollknäuel. Ich verzählte mich jedes Mal. Waren es sechshundert, oder doppelt so viel? Während die Zahlen noch in meinem Kopf schwirrten, lag ich schon in deinen Armen.
Auf dem Rückweg waren es genau ein Tausend Kastanienbäume. Da verzählte ich mich nie. Ein Tausend Kastanienbäume, jeder ein Zeuge unserer Trennung.
In diesem ganzen Sommer hatte es nur einmal geregnet, dreimal war der Himmel bewölkt und vier Gewitter gab es. Ich lief jeden Tag. Es war der erste Sonntag im August, ich weiß es noch genau, da lief ich besonders schnell und kam zu früh zu deinem Haus. Diesmal hatte ich mich nicht verzählt, es gab genauso viele Birken wie Kastanienbäume. Als ich anklopfte, blieb deine Tür zu. Abweisende Stille schlug mir ins Gesicht. Die Sonne schien so stark, als wollte sie die geschlossene Tür durchbrennen. Ich setzte mich auf die Fußmatte und wartete. Nach einer Stunde sinnlosen Wartens kehrte ich zurück in mein Heimatdorf, die Kastanien zählte ich nicht.
Dann habe ich gewartet, in meiner Kammer. Zusammengerollt, den Kopf auf den Knien, wartete ich. Die Fliegen summten besonders laut diese Tage.
Es wurde September, du standst vor meiner Tür. Ob du auch die Bäume gezählt hast, die Gerüche wahrgenommen, den Boden nur leicht unter den Füßen gespürt? Nein, du bist mit Bauer Hans gekommen, er ließ dich auf dem Anhänger mitfahren. "Tausend sind es. Tausend", sagte ich zu dir. In mir brodelte es: "Warum bist du nicht zu mir gelaufen? Vier Wochen war es her, als ich vor deiner Tür stand und vergessen habe die Kastanien zu zählen. Achtundzwanzig Tage wartete ich." Die Wut packte mich, Zweifel schüttelten mich, ich wünschte dir jeden Tag das Schlimmste und doch wurde meine Sehnsucht immer größer.
Als du dann vor meiner Tür standst, war ich kurze Zeit beleidigt, dann verließ mich mein Stolz…. wie eine untreue Katze, und ich fiel in deine Arme, als wäre nichts passiert. Weg war das Warten, weg die Vorwürfe. Was nützte der Stolz, wenn Glück ihn ablöste?
"Komm", sagtest du lachend, "wir fahren zusammen in die Stadt und ich zeige
dir, wie das Leben geht."
Natürlich ging ich mit, ich war schon lange neugierig auf diese Stadt und auf das Leben.
In der Stadt sagtest du, "nimm dieses Kleid, und die Schuhe, färbe deine Haare grün." Zwei Wochen blieben wir.
Als wir zurückkamen, ich im Kleid, wie die Städter sie trugen, die Schuhe rot, die Haare grün, wurde gerade eine Hochzeit im Dorf gefeiert. Die Glocken läuteten, die Gäste warteten vor der Kirche im Sonntagsstaat.
Die Braut im Weiß auf der breiten Treppe,
der Vater führte sie am Arm.
Als er dich entdeckte, rannte er auf dich zu. "Hast du die Ringe?", fragte er dich leise.
Du bejahtest, holtest ein kleines Päckchen aus der Tasche, nahmst den viel zu dürren Arm der Braut und führtest sie zum Altar.
Ich hätte mich nicht so oft verzählen dürfen.
**Alle Rechte vorbehalten. Kopieren und Verbreiten dieser Leseproben, auch auszugsweise, ist ausdrücklich untersagt und bedarf einer schriftlichen Genehmigung der jeweiligen Autorin/nen.**